Etablierte Mitte-links-Parteien werfen aufstrebenden rechten Parteien Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit vor. Rechte Parteien wiederum greifen die dominierenden Mitte-links-Parteien aggressiv an. Sie vertreten den Standpunkt, dass zu viele Zuwanderer ins Land gelassen und diese unzureichend integriert wurden.
Wie dieser politische Kampf letztlich ausgeht, kann heute niemand vorhersagen. Fakt ist: Die Hintergründe dieses äußerst überspitze Phänomens sind vielschichtig.
Ausgangslage
In allen Ländern der Erde besteht ein unübersehbares politisches Interesse an wirtschaftlicher Expansion. Alle – gleich ob linke oder rechte Parteien – sind sich in einer Frage erstaunlich einig: Die Welt kann am ehesten durch Wirtschaftswachstum und Konsum gerettet werden. Etwas anderes als „Wir müssen wettbewerbsfähiger werden“ ist kaum irgendwo zu hören.
Es handelt sich um eine globale Weltsicht, der alles untergeordnet wird – auch der Naturschutz, das Bildungssystem und selbstverständlich die Zuwanderungspolitik. Um das System und den Wohlstand zu erhalten, brauche es Zuwanderung und leistungsfähige Bildung – so lautet Kernbotschaft unserer Zeit. Auch in Österreich.
Diese auf Konkurrenz setzende Entwicklung, die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks (1989) nochmals beschleunigt wurde, ist nicht neu. Neu ist jedoch die dichte Vernetzung, die durch die globale Wirtschaft und das Internet zwischen Staaten und Menschen entstanden ist. Wir sind Zeugen einer nie dagewesenen Vielfalt an kultureller und sozialer Diversität. Gleichzeitig nehmen Kriege und Radikalisierungen zu.
Warum eigentlich? Weil die zunehmende globale Vernetzung beim besten Willen nicht dazu beiträgt, einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen friedfertig und besonnen in die Zukunft blicken. Wir leben nicht in einem Resonanzraum, die Welt ist kein „Happy Place“. Um das zu erreichen, bräuchte es deutlich bessere zwischenmenschliche und zwischenstaatliche Beziehungen.
Im Moment wäre es bereits ein Fortschritt, eine rudimentäre friedliche Koexistenz verfeindeter Staaten zu etablieren. So weit ist es schon gekommen. Und natürlich, die weltweite Ausbeutung der Natur zu beenden. Es bräuchte, um den Weltfrieden wiederherzustellen, also brauchbare politische Ansätze.
Demokratische Systeme
Von autokratischen und illiberalen Systemen sind humanistische Ansätze kaum zu erwarten. Doch selbst liberale Demokratien tun sich etwa mit dem Umweltschutz schwer, und auch die Frage der Toleranz ist noch ungeklärt.
Die kulturelle Vielfalt stellt gewiss eine Herausforderung dar. Die Frage, wie mit ihr umzugehen sei, fand bislang keine befriedigende Antwort. Die etablierten Parteien verteidigen seit vielen Jahren ihre multikulturell geprägte Toleranzhaltung – eine Position, die neuerdings als „Wokeness“ bezeichnet wird.
Auf der anderen Seite steht eine streng autoritäre, im Zeichen der „Leitkultur“ stehende Toleranzhaltung. Der Slogan „America first“ liefert dazu Basis und Zündstoff. Rechte Parteien und deren Anhängerschaft fordern – ähnlich wie in autoritären Systemen – vor allem von Zugewanderten vollständige Anpassung.
Der deutschsprachige Raum
Im deutschsprachigen Raum hat die an der Leitkultur orientierte (rechte) Toleranzhaltung, jenes „Wir zuerst“, keine dominante Position – weder in der Bevölkerung noch in der Politik. Der politische Diskurs in Österreich und Deutschland wird derzeit von einer multikulturellen, großzügigen und humanistischen Toleranzhaltung bestimmt. Doch diese humanistische Haltung, die sich im Rahmen der „Erinnerungskultur“ herausgebildet hat, stößt zunehmend auf Widerstand – sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung.
Dieser Widerstand ist im östlichen Teil Deutschlands – wegen der historisch bedingten Abwesenheit der Erinnerungskultur deutlich stärker ausgeprägt als im westlichen. Ostdeutschland „tickt“ weiterhin fremdenfeindlicher, ähnlich wie andere ehemalige Ostblockländer, einige autokratische und illiberale Staaten sowie deren Bevölkerung (auch die ausgewanderte).
Der wachsende Widerstand gegen die Willkommenskultur führt zur Bildung von Gruppen und Bewegungen, die immer weniger bereit sind, als ungerecht empfundene Entwicklungen respektvoll und argumentativ zurückzuweisen. Stattdessen nehmen Überreaktionen und Gewalttaten zu – und zwar in alle Richtungen, unter anderem gegen Personen oder Gruppen, die „Wokeness“ vertreten.
Die Etablierung solcher häretischer Positionen sind zentrale Anliegen rechter politischer Kräfte. Die Expansion der entgrenzten Toleranz liberaler Gesellschaften kann daher als eine der Ursachen für den Vormarsch rechter Parteien und anderer Radikalismen gesehen werden.
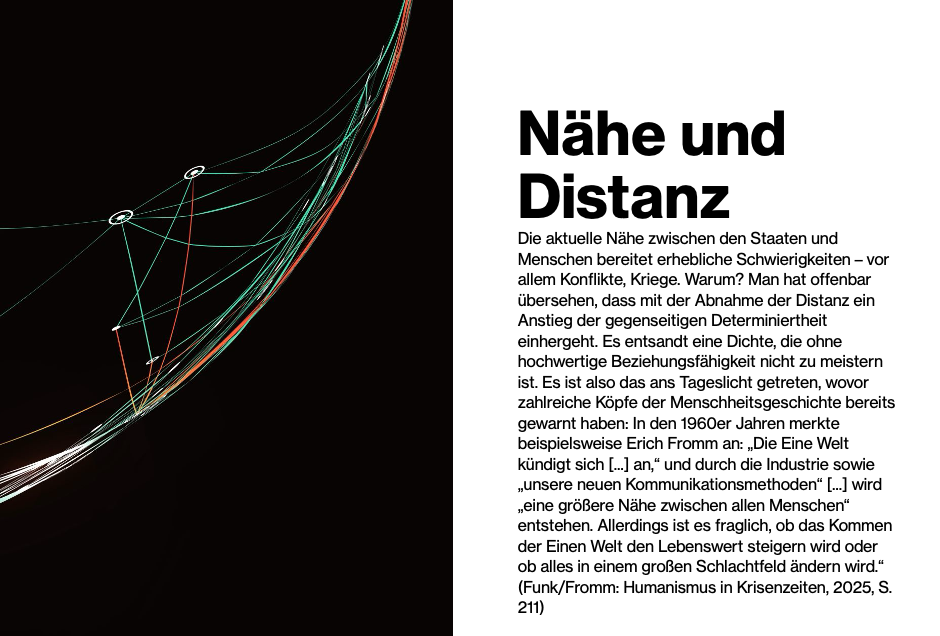
Der gute Mensch
Man kann sich noch so sehr für Vielfalt aussprechen – das allein reicht leider nicht aus. Vielfalt und Diversität brauchen verbindende Werte, Vertrauen sowie eine nachhaltige Form der Toleranz.
Moderne, nachhaltige, politisch relevante Toleranz hat allerdings weder mit bloßem Dulden noch mit uneingeschränkter Wertschätzung zu tun. Sie bedeutet entweder eine auf stichhaltigen Argumenten basierende Akzeptanz oder eine respektvolle, gut begründete Zurückweisung von als störend oder ungerecht empfundenen Handlungen. Nachhaltige Toleranz liefert also gut begründete Argumente für die jeweilige Position.
Weder der rechte Leitkulturansatz noch die linke Wertschätzung liefern dafür die Basis. Um die Radikalisierungsspirale und den Vormarsch rechter Parteien zu stoppen, müsste dringend eine differenzierte Haltung zwischen rigoroser Leitkulturmentalität und unreflektierter Willkommenskultur gefunden werden – ein „Toleranzkompass“, der sachlich anzeigt, welche Verhaltensweisen demokratisch und welche menschenverachtend sind.
Die Bewertung von Verhaltensweisen sollte auf Grundlage der Grund- und Menschenrechte getroffen und sorgfältig abgewogen werden: Die Argumente für eine bestimmte Haltung – etwa ob Deutschkenntnisse für alle verpflichtend sein sollten – kämen beispielsweise in die Waagschale der „Akzeptanz“, die Gegenargumente in die Waagschale der „Ablehnung“.
Stolpersteine
Ideologische Ansätze müssen bei solchen Überlegungen außen vor bleiben. Besonders schwierig zu bewerten sind dabei kulturelle, religiöse und ethnische „Identitätsfragen“ – gerade in Deutschland und Österreich. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist es in beiden Ländern tabu, andere Kulturen zum Gegenstand der Analyse zu machen, geschweige denn sich über andere „Identitäten“ kritisch zu äußern.
Diese an sich humane Haltung, deren Wurzeln – so seltsam es klingen mag – zu einem großen Teil in Hitlers vernichtender Politik verankert liegen, ist mittlerweile weit verbreitet. Vieles deutet sogar auf eine Art gebrochenen Habitus hin, das heißt, auf eine nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene sukzessive Wandlung des österreichischen und deutschen Charakters von narzisstischer Selbstverherrlichung und Expansionsdrang hin zu überbordend verinnerlichter Selbstkritik und Menschenliebe.
Natürlich ist letztere Haltung viel wert. In Migrationsfragen ist sie jedoch einseitig, man möchte fast sagen, blauäugig. Wäre es nicht besser, auf der Basis von humanistischen Argumenten zu verhandeln und nicht auf jener von Befindlichkeiten beziehungsweise aufgrund bloßer ökonomischer Vorteile?
Ob und inwiefern die neuen Regierungen in Österreich und Deutschland es schaffen, hier eine neue Balance zu finden, wird sich zeigen.